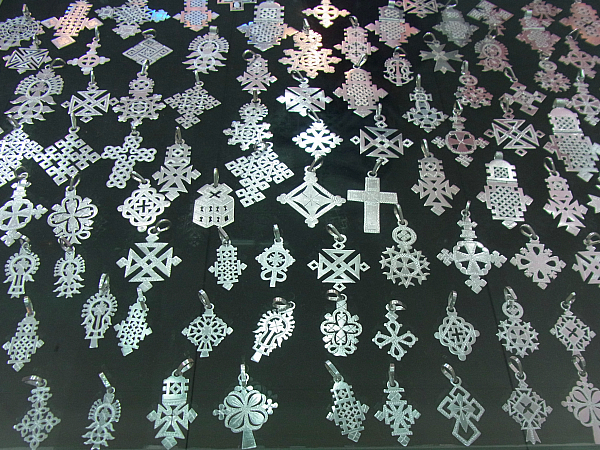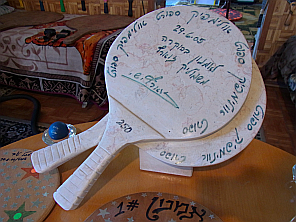308 Tage, das ist kein schlechter Schnitt auf einer Weltreise. 308 Tage hat es gedauert, bis das Unvermeidliche passiert ist: Mir ist heute meine Tasche geklaut worden.

Am meisten ärgere ich mich über mich selbst, denn ich weiß es ja besser. Hab das Ding immer schön quer vorm Körper getragen, im Gedränge auch mal unter den Arm geklemmt. Ich kenne alle Tricks, bilde ich mir ein, alle Ablenkungsmanöver. Aber heute habe ich die Tasche wie der größte Anfänger aller Zeiten kurz neben mich gestellt, es war am gottverlassenen Derg Monument, einem kommunistischen Mahnmal. Oben vor dem Monument weit und breit keine Menschenseele zu sehen – bis auf den Moment, wo sich ein Junge (ich glaube: der ganz links außen auf dem Foto oben) sich lautlos von hinten anschlich, die Tasche griff und loswetzte. Ich für hundert Meter brüllend hinterher, klar, aber das Bürschchen war schneller, vor allem, als er sich in die Büsche schlug. Mann, habe ich geflucht.
In der Tasche war mein Kindle (Mist), zwei kurz zuvor gekaufte Bücher über Addis und Äthiopien, Sonnenbrille (bei dem Wetter eh nicht nötig) und meine Geldbörse mit umgerechnet etwa 50 Euro. Glücklicherweise hatte ich vor meinem Spaziergang die größte Menge des Bargeldes, Kreditkarten, Führerschein und Pass in den Hotelsafe gepackt. Handy, Hotelkeycard und Fotoapparat waren in meiner Jackentasche. Denn ich bin zwar blöd, aber nicht so blöd. Der Schaden ist also eher ein ideeller, denn diese Tasche begleitet mich seit Sydney, ich habe sie sehr lieb gewonnen und hätte sie gern als Andenken an die Reise behalten. Und der Verlust des Kindle schmerzt natürlich. Andererseits: Alle gekauften Kindle-Bücher habe ich auch auf einer App in meinem iPhone, ein Hurra auf die Technik.

Was nicht geklaut worden ist: ein Tütchen mit diesem bezaubernden sahnegefüllten Spritzgebäck-Schwan aus einer Bäckerei an der Churchill Avenue. Der wird jetzt gerade, während ich dies schreibe, zu einer Kanne Earl Grey gegessen.
Und wenn ich schon dabei bin: Hier ein paar Fotos von meinem heutigen Streifzug.

Die St. George Cathedral ist ein ungewöhnlicher Rundbau. Die Gläubigen wandern gegen den Uhrzeigersinn um sie herum und küssen sie in regelmäßigen Abständen, die Türen waren alle geschlossen. Ich, im Uhrzeigersinn gehend, wurde gemahnt, die Richtung zu ändern – das würde mich mehr öffnen.

Die Cunningham Street im Bereich Piazza (oder Piassa, die Schreibweise wechselt) ist eine der zentralen Einkaufsstraßen von Addis Abeba.

Haile Selassie Street, ebenfalls im Zentrum.

Schon mal ein Vorgeschmack auf Kuba: Alte Käfer gibt es hier in rauen Mengen.


Die Beschilderung ist, wie so oft in Afrika, kreativ bis unlesbar. Das gilt übrigens auch für die Straßenschilder. Kürzlich sind in einer Hauruck-Aktion 52 Straßen nach Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union umbenannt worden, offenbar in Reaktion auf die Drohung, den Hauptsitz in eine andere afrikanische Stadt zu verlegen. Bedeutet: Alle Straßenpläne sind Makulatur.

Bar.

Schlachter.

Bücherstände.

Einer der größten Buchläden, Megabooks. Interessanterweise ausschließlich Fachliteratur. Buchhaltung, Ingenieurswissenschaften, Englisch als Fremdsprache. Halt alles, was wirklich wichtig ist in so einem Land.

Eine ziemlich typische Straßenansicht. Wellblechsiedlungen, dahinter Hochbauten in verschiedenen Phasen der Fertigstellung. Und davor, an der Mauer, improvisierte Zelte aus Lastwagenplanen, aber auch Leute, die einfach nur zusammengerollt in einem Plastiksack schlafen, direkt auf der Straße, im Regen. Der Anblick ist für mich immer noch erschütternd, obwohl ich merke, dass mich nach Indien nichts mehr so leicht schockiert.




Kaffee ist ein Riesenthema hier in Addis wie auch sonst in Äthiopien, das sich selbst als Urland des Kaffees betrachtet – sehr schade, dass ich Teetrinkerin bin, denn der Geruch, der aus den Kaffeebars in die Straßen weht, ist köstlich. Eine der besten (mit angeschlossener Rösterei) ist das Tomoca in der Wavel Road (Nähe Churchill Avenue). Kaffee-Aficionados rösten selbst in kleinen Pfannen und mahlen per Hand, alle Geräte kann man hier kaufen.
Ich jetzt aber: Schwan & Tee. Schwanentee. Und Montag eine neue Tasche und ein neues Portemonnaie kaufen. Wenn ich ein Talent habe, das beim Reisen wirklich nützlich ist, dann dieses: So was wie einen Diebstahl nie persönlich nehmen. Denn das ist er nicht. Gerade in einem Land wie Äthiopien ist er nur eine fällige Umschichtung von Reich zu Arm.