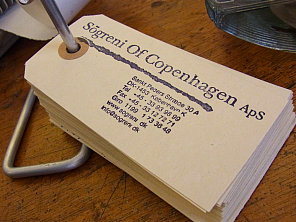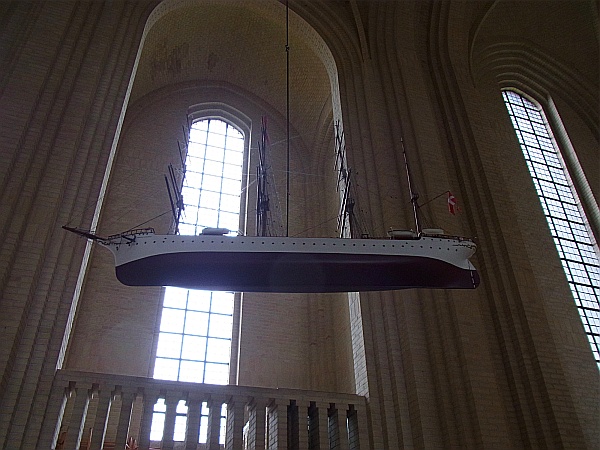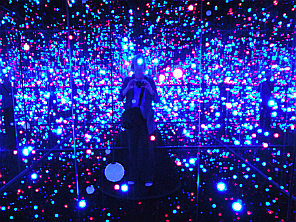Unter die Räder geraten
37 Prozent der Kopenhagener fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, die Stadtverwaltung will diese Zahl bis 2015 auf 50 Prozent erhöhen und baut dafür 26 Fahrrad-Superhighways, vor allem in den Vorstädten. Schon jetzt hat die Stadt eines der besten Radnetze der Welt – und einige Albernheiten, mit denen Radler bepuschelt werden: Fußbänkchen an großen Kreuzungen, so dass man nicht mehr absteigen muss, und geneigte Mülleimer, in die man seinen Müll quasi im Vorbeifahren entsorgen kann.
 Das Programm, Kopenhagen zur Weltfahrradhauptstadt zu machen, ist so erfolgreich, dass sich jetzt neue Probleme ergeben: wo parkt man die Dinger? Rund um die großen S-Bahnstationen wie Nørreport stapeln sich die Räder, Ständer werden bereits doppelstöckig gebaut, sogenannte Fahrrad-Butler versuchen, halbwegs für Ordnung zu sorgen, und die Verwaltung denkt über Knöllchen für wildgeparkte Räder nach: Offenkundige Schrotträder könnten einkassiert und erst gegen Zahlung wieder freigegeben werden. Noch gibt es keine Meldepflicht für Räder, aber kürzlich hat ein Ingenieur den Prototyp einer Parkscheibe für Fahrräder vorgestellt: Man müsste den Tag eingeben, an dem man sein Rad abstellt, und das mit einem Schlüssel sichern. Wenn das Datum länger als 30 Tage zurück liegt, dürfte die Polizei das Rad entfernen. Kaum vorstellbar, dass das durchgesetzt wird, aber irgendwas Schlaues müssen sie sich bald einfallen lassen – die Fahrradpolitik ist einfach zu erfolgreich.
Das Programm, Kopenhagen zur Weltfahrradhauptstadt zu machen, ist so erfolgreich, dass sich jetzt neue Probleme ergeben: wo parkt man die Dinger? Rund um die großen S-Bahnstationen wie Nørreport stapeln sich die Räder, Ständer werden bereits doppelstöckig gebaut, sogenannte Fahrrad-Butler versuchen, halbwegs für Ordnung zu sorgen, und die Verwaltung denkt über Knöllchen für wildgeparkte Räder nach: Offenkundige Schrotträder könnten einkassiert und erst gegen Zahlung wieder freigegeben werden. Noch gibt es keine Meldepflicht für Räder, aber kürzlich hat ein Ingenieur den Prototyp einer Parkscheibe für Fahrräder vorgestellt: Man müsste den Tag eingeben, an dem man sein Rad abstellt, und das mit einem Schlüssel sichern. Wenn das Datum länger als 30 Tage zurück liegt, dürfte die Polizei das Rad entfernen. Kaum vorstellbar, dass das durchgesetzt wird, aber irgendwas Schlaues müssen sie sich bald einfallen lassen – die Fahrradpolitik ist einfach zu erfolgreich.