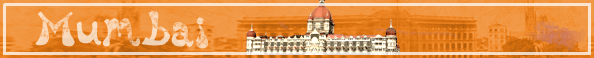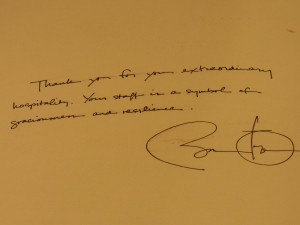Am Ende einer kurzen Nacht
Freitag, 11. März 2011Nach einer Woche Mumbai. Nach drei Stunden Schlaf. Während die Sonne hinter der staubigen Scheibe aufgeht.
B ist 28, halb Deutscher, halb Australier. Abgebrochenes Volkswirtschaftsstudium an der Uni München, hängengeblieben in Indien. Er ist drei Monate durchs Land gereist, getrieben von Hesses Siddharta und Shantaram von Gregory David Roberts. Er hatte sich selbst beweisen wollen, dass er von 150 Rupien am Tag leben kann, dem indischen Durchschnittseinkommen. 2,50 Euro. Er hat es drei Monate lang durchgehalten: Von Kalkutta ist er per Zug, oft 12 Stunden im Stehen zwischen anderen eingeklemmt, von Kalkutta Richtung Süden bis nach Kerala und dann an der Westküste wieder hoch nach Mumbai gereist. Halbnackt im Lunghi, dem südindischen Wickelrock, im Rucksack 15 Kilo Kletterausrüstung. Ein paar Mal ist er in ungemütliche Situationen geraten, auch mal verhaftet worden. Das Shantaram-Leben. Über eine Facebook-Bekanntschaft ist er an einen Job als rechte Hand eines indischen Geschäftsmanns aus dem Restaurantgewerbe gekommen, für den er jetzt mit Unterbrechungen seit knapp einem halbem Jahr arbeitet. Was genau macht er da? „Alles, was anliegt.“ Nach dem Rechten sehen, den Angestellten wieder und wieder sagen, wie etwas zu tun ist. Weil das hier einfach nicht anders ginge, jeder einzelne Handschlag müsse genau vorgeschrieben und ausdrücklich verlangt werden. Er sagt das zu einem Viertel resigniert, zu einem Viertel zornig, zu einem Viertel verächtlich, zu einem Viertel sachlich, in diesem Tonfall, den ich so oft höre, wenn ich Westler über Inder reden höre. Es ist eine Stimme auf verlorenem Posten.
Wir sitzen im Indigo, einem der angesagtesten Restaurants in Mumbai, einen Steinwurf vom Taj Mahal Palace entfernt. Ein Laden für Expats und reiche Touristen, ein dreigängiges Menü für zwei kommt hier auf für Indien exorbitante 100 Euro. Es ist voll, natürlich. Zweiertische mit der international bewährten Kombo von altem Knacker und junger Frau, eine lange Tafel voller Männer, die anerkennend jaulen, als sich vier, fünf Frauen in mehrheitlich kurzen Röcken zu ihnen gesellen, die aussehen wie Professionelle.
B erzählt von seinen Reisen, von der Arbeit, von Indien. Die Erzählungen verästeln sich, er schweift ab, schiebt ein, erklärt, fällt sich selbst ins Wort. Anders kann man von Indien scheinbar nicht sprechen. Immer wieder Anekdoten, eine absurder als die andere, ich interpunktiere mit Kopfschütteln und ungläubigem Lachen. Aber nicht sehr ungläubig, denn so ist es, ich erfahre es ja gerade selbst.
Das Essen ist mäßig, ein ungelenker Versuch, den globalen Geschmack zu treffen. Ich esse Rawas, einen lokalen Fisch, mit Anis, gerösteter Kokusnuss und Panchamrut-Sauce, sinnlos verhunzt durch Artischocken und schwarze Oliven. Möchtegern-Essen. Der Kellner breitet mit Schwung eine schwarze Serviette über meinem Schoß aus, die Gabel ist verbogen. Wie erfolgreich der Laden ist, zeigt ein Schild vor der Tür. Dort wird ein neuer Service angeboten: „Let our chauffeur drop you home in your car. Indigo encourages responsible drinking.“
Wir ziehen ein paar Häuser weiter, in den Royal Bombay Yacht Club. Ein riesiger viktorianischer Bau in bester Lage, von der Terrasse schaut man auf das Gateway of India und das Arabische Meer. Einst der Stolz der britischen Seefahrt, jetzt ein verwahrloster Kasten mit grellen Neonlampen. Hier findet heute abend der monatliche Cigar Club statt, ebenfalls ein Treffpunkt für in Mumbai lebende Ausländer, initiiert von einem Briten namens Dan. „Der da drüben im gestreiften blauen Hemd ist Dan“, sagt B. Ich muss lachen, denn hier tragen tatsächlich alle gestreifte blaue Hemden, die offizielle Wir sind heute mal lässig-Uniform der versammelten Geschäftsführer, Repräsentanten, Niederlassungsleiter aus aller Herren Länder. Zwei Deutsche lehnen mit einem Bier in der Hand an der Brüstung, ich höre nur Wortfetzen: „…weiß auch nicht mehr, wie… Report… die Zentrale sagt…“ Man wärmt sich hier am Feuerchen ähnlicher Erfahrungen, so scheint es. Alle sehen müde aus.
Weiter, hinaus zur Pferderennbahn. Im „Tote“ findet eine Party zur Eröffnung der Lakmé Fashion Week statt. Ein Bekannter von B schleust uns hinein. M, Australier, leitet eine Modelagentur. Gute Mädchen habe der M, sagt B, die halbe Vogue India sei voll mit ihnen. Derzeit gehen Brasilianerinnen gut, auch Spanierinnen – dunkelhaarig genug, um sich mit ihnen identifizieren zu können, aber auch genügend nicht-indisch, um aspirational zu sein, Sehnsucht nach einem anderen, besseren Leben auszulösen. Das, worum es hier immer geht, auch bei denen, die es schon längst geschafft haben. M und sein Bruder U haben drei Models im Schlepptau, alle schön, alle dunkelhaarig, alle nicht-indisch. B zeigt auf ein paar Leute. Der Typ da: ein paar 100 Millionen schwer. Der: auch. Alle im blauen Streifenhemd. Dazu ein paar bekannte Gesichter aus dem Cigar Club, die inzwischen auch den Weg hierher gefunden haben. Man kennt sich, und man bleibt unter sich. U, der Bruder von M und gerade zu Besuch, überlegt, ob er jetzt auch nach Indien ziehen soll. Warum? „Weil hier noch alles möglich ist“, sagt er mit Goldgräberblick.
Die Welten berühren sich hier nicht. Ich verstehe jetzt, warum ich jedes Mal so fassungslos angestarrt werde, wenn ich im Viertel rund um mein Hotel durch die Straßen gehe. Warum mich auch neulich die Männer in der S-Bahn so angestarrt haben. Ich hatte dort einfach nichts zu suchen. Ich hätte noch nicht mal was im Frauenabteil zu suchen gehabt, auch nicht in der ersten Klasse. Ich bin eine weiße Frau, für indische Verhältnisse stinkreich, ich darf bestenfalls im Taxi unterwegs sein, aber in Wirklichkeit nur in einer eigenen Limousine mit Fahrer, sagen mir die Mädchen von M. Im bereits zitierten „Bombay: Maximum City“ schreibt Suketu Mehta, dass er, der aus New York nach Mumbai zog, aus einer funktionierenden Stadt in eine nicht funktionierende, auch in ein fremdes Leben geworfen wurde, in eines mit Dienstmädchen und einem klimatisierten, Chauffeur-gesteuerten Wagen. „Wenn wir hier überleben wollen, müssen wir reich leben“, schreibt er, einigermaßen verzweifelt.
In ihrem Weblog Diary of a White Indian Housewife, das ich gerade fasziniert verfolge, schreibt die Australierin Sharell Cook, die einen indischen Mann geheiratet hat, viel von dem, was mich auch so umtreibt in dieser Stadt: die Einsamkeit, die Fremdheit, die Unzugehörigkeit. Was sie nicht sagt: wie man sich hier selbst fremd wird. Wie schnell man sich gegen das Elend panzert, wie kalt das Herz plötzlich wird. Wie wütend man durch die Stadt läuft, weil einen schon wieder jemand versucht hat zu verarschen, ein Händler, ein Taxifahrer, der „vergessen“ hat, die Uhr anzustellen, und jetzt einen Fantasiepreis verlangt, eigentlich jeder, mit dem man als Fremde in Kontakt kommt. Der Mann an der Rezeption, von dem ich regelmäßig zehn Stunden Internetzugang kaufen muss, hat plötzlich keine Zehn-Stunden-Tickets mehr, aber ich könnte zwei Tickets à fünf Stunden haben, leider ein bisschen teurer. Okay, mache ich. Am nächsten Tag: Es gibt wieder nur die Fünf-Stunden-Tickets. Auf denen aber nur 240 Minuten drauf sind. Am übernächsten Tag: geht das Internet gar nicht mehr, ein Techniker kommt, drückt ein bisschen auf meinem Laptop herum, wackelt mit dem Kopf, holt dann seinen eigenen Rechner und demonstriert, dass das Netz funktioniert. Und bietet nach einem Telefonat mit der Rezeption an: Ich könnte auch für 1000 Rupien Zugang für einen ganzen Tag kaufen, der sei zuverlässiger. Ich nicke entnervt, mir ist schon alles egal. Hauptsache, es funktioniert wieder. Hauptsache, ich muss mich nicht immer wieder mit demselben Mist beschäftigen. Muss ich natürlich, denn es funktioniert immer noch nicht. An guten Tagen nehme ich all das als ein Spiel. An schlechten nehme ich es persönlich. Heute ist ein eher schlechter Tag, würde ich sagen.
Und genau so geht hier alles, so kriegt man die Westler an ihrer Ungeduld und ihrer fehlenden dicken Schwarte zu packen: Man nervt sie. Es ist ein täglicher Kleinkrieg. Bettler ziehen so lange an einem, bis man ihnen einmal entnervt was gibt, damit sie verschwinden. Straßenhändler schmeißen sich einem so lange mit „Ma’am, look, ma’am, hello, hello, look, ma’am, look, hello, ma’am“ in den Weg, bis man einmal stehen bleibt. Das Nerven klappt vielleicht in einem von 100 Versuchen, aber das reicht. Und deshalb wird es gemacht. Es ist wie Spam. Das Verarschen klappt häufiger, und deshalb wird es erst recht gemacht.
Ich habe mich jetzt drei Tage mit dem verdammten Internet herumgeärgert, und nun bin ich marode. Mein Budget ist nach zehn Tagen Mumbai praktisch unberührt, ich kann es ohnehin für nichts anderes ausgeben als für meine Infrastruktur. Ich gebe mir noch einen Tag, dann ziehe ich in ein teureres Hotel, auch wenn ich dieses hier schon bezahlt habe und das Geld nicht wiedersehen werde. In eines mit funktionierendem Netz, wo einen die Housekeeping-Boys nicht schon morgens um halb acht aus dem Schlaf klopfen, wenn man vergessen hat, das Do Not Disturb-Schild rauszuhängen. In eines, in dem man nicht jede Rolle Klopapier extra ordern muss. Die Inder benutzen keins, sie finden Klopapier so eklig wie Küsse. Sie nehmen Wasser und die linke Hand; deshalb wird auch nur mit der rechten Hand gegessen. Was ich brav ebenfalls tue, denn es gehört sich hier so. Ich esse mit der Rechten, weil ihr euch mit der Linken den Hintern abwischt, verdammt. Also hört auf, mich immer zu verarschen.
Oder ich bleibe einfach. So schnell werdet ihr mich nicht klein kriegen.