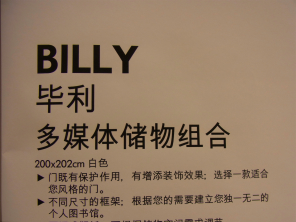Heiraten auf chinesisch
Aus gegebenem Anlass: ein nachgereichtes Foto vom wöchentlichen Heiratsmarkt am People’s Square. Hier preisen jeden Sonntag Eltern und Großeltern ihre unverheirateten Kinder und Enkel an – oft ohne deren Wissen. Auf den in die Bäume und Büsche gehängten Zetteln stehen die wichtigsten Daten: Alter, Größe, Einkommen. Und gern auch ein paar Charakterbeschreibungen: „sanftmütig“, „genügsam“… Bei Interesse kann man sich gleich mit der danebensitzenden Mutter unterhalten und einen Einblick in die Familie bekommen, denn die wird hier mitgeheiratet. Fotos der Kinder sieht man dagegen eher selten auf den Blättern. Und jetzt: die andere Hochzeit.
…oder schläfst du schon?
BILLY. KLIPPAN. LACK. Köttbullar. Hotdogs. Alles da, alles wie zuhause. Bis auf die Chinesen, die hier wohnen. Richtig wohnen: Sie schlafen eine Runde auf dem RÖRBERG-Sofa, sie nehmen ein kleines Picknick in der FAKTUM-Wohnküche ein und arrangieren anschließend noch schnell die Bilder um. Shanghai hat angeblich den größten Ikea Asiens, auch an einem Wochentag ist der Laden voll. Im Restaurant gibt es außer Köttbullar zwar auch Fried Beef with Hot Pepper and Rice, aber die meisten essen lieber Mandeltorte (mit Gabeln natürlich). Billig ist es hier übrigens nicht: Der LACK-Couchtisch, in Deutschland 4,99 Euro, kostet hier umgerechnet 4,15 Euro. Der Hotdog dafür aber nur 35 Cent.
Turbotown
Sehnse, det is Shanghai. Vorgestern war hier in der Taikang Lu noch ein Loch im Haus, gestern wurde den ganzen Tag gezimmert, heute stellen sie schon mal einen Koch mit dem Menü hinter einen gedeckten Tisch, damit man weiß, was man ab morgen hier essen kann. Shanghai-Jahre sind wie Hundejahre, sagte mir jemand heute nachmittag, alles geht hier siebenmal so schnell wie anderswo.
Großstadtdschungelcamp
Warnung: Dieser Beitrag ist nichts für Empfindliche, Magenkranke und Raupenfreunde. Wollte ich nur gesagt haben.
„Die Libellen musst du gut kauen, die Flügel können sonst beim Runterschlucken stecken bleiben“, sagte Kyle. Ein guter Rat, aber im Notfall hätten wir die Libellen mit Erdinger Weißer heruntergespült.
Mit Jamie und Kyle war ich schon einmal auf Foodtour unterwegs, dieser Abend aber sollte etwas… herausfordernder werden. Die Weird Meat Tour führt in Hinterhofrestaurants und auf Nachtmärkte, auf der Suche nach Dingen, die man nicht so oft auf den Teller bekommt. Es begann im Southern Barbarian mit fritierten Honigbienen (obere Reihe), serviert mit Dörrfleisch und Malzfritten, dann Wasserwanzenlarven, Libellen und Bambuswürmer (Mitte links, rechts noch mal die Libellen größer). Es klingt alles schrecklich nach Dschungelcamp, schmeckt aber verblüffend lecker. Knusprig, wie Kartoffelchips oder Popcorn. Halt wie etwas, was man gedankenlos vor dem Fernseher isst, nicht weiter der Aufregung wert. Fast noch verblüffender: die Auswahl an europäischem Bier, eine Leidenschaft des Wirts. Aus Deutschland war außer Erdinger – im Original Weißbier-Glas, vom Kellner fachmännisch eingeschenkt – auch Einbecker Doppelbock dabei.
Zweite Station: Bi Feng Tang, ein kantonesisches Kettenrestaurant, das 24 Stunden geöffnet hat. Hier: Taube (mit Kopf serviert) und Entenzungen (unten). Taube kannte ich schon. An chinesischen Täubchen ist allerdings kaum Fleisch dran, sie taugen eher als Zahnstocher. Entenzungen hingegen: interessant. Die Zungenspitze lässt sich gut abbeißen – Konsistenz: in etwa wie roher Schinken –, dann arbeitet man sich um das Zungenbein herum, wieder eine elende Zuzelarbeit. Aber ich hatte ja schon genügend Bienen im Magen, der erste Hunger war gestillt.
Weiter: Li Jian Jun. Große Heiterkeit beim Lesen der Karte. Old dopted mother eleusine? Tile fish homesickness? Acid cowpea flashy foam? Nicht mal die Bilder können einem hier sehr weiterhelfen. Wir bestellten Stir fatty intestine: gebratener Schweinedarm mit unglaublich viel Chili. Auch das nicht so eklig wie es klingt. Aber auch nichts, was ich beim nächsten Mal wieder bestellen würde. Stattdessen lieber noch mal die Lotuswurzeln.
Zum Schluss: Nachtmarkt. Gebratener stinky tofu mit süßer Sauce: nicht so stinky, wie sein Name androht, eher wie reifer europäischer Käse. Danach konnten wir nicht mehr und haben uns geärgert: Flusskrebse, Austern, riesige, frisch geöffnete Jakobsmuscheln…
Alles mindestens einmal probiert und dabei festgestellt: Alles ist essbar, vieles sogar genießbar. Die Shanghaierin Shirley, die dabei war, winkte aber trotzdem bei dem meisten ab.
Ach so, und: kein Hund, es ist nicht die richtige Jahreszeit. Hund isst man im Winter.
Southern Barbarian, 2/F, Ju’Roshine Life Arts Space, 169 Jinxian Lu, in der Nähe der Maoming Nan Lu
Bi Feng Tang, 175 Changle Lu, Nähe Maoming Nan Lu
Nachtrag 27. April: Das fand ich heute im Supermarkt. iDuck Series? Fantastisch.
Einen im Tee
Abwarten ist nicht nötig, um in China Tee zu trinken. Die hiesige Methode der Zubereitung ist nämlich deutlich fixer als die anderer Teenationen. Zunächst: Das Foto oben links täuscht. Das Tässlein vorn rechts hat etwa den Durchmesser von zum Kreis geschlossenem Daumen und Zeigefinger. Machen Sie das gerade? Gut. Das Kännchen entsprechend: Puppenstubenformat. Die linke, höhere Tasse ist ein Riechtässchen, es wird beim Servieren des ersten Aufgusses in die Trinktasse gestülpt und einem dann zum Schnuppern des Aromas unter die Nase gehalten.
Die Zubereitung funktioniert folgendermaßen: Das Tonkännchen wird mit großzügigen sieben Gramm Teeblättern gefüllt, in diesem Fall einem Oolong Tienguanyin. 100 Milliliter kochendes Wasser (es ist Oolong! Bei grünem Tee 75 Grad) werden darüber gegossen, der Tee zieht 30 Sekunden und wird dann in den kleinen Glaskrug abgeseiht. Das Ganze kann man bis zu zehnmal wiederholen. Und so war es auch heute im Song Fang Maison de Thé: Immer wenn der Krug leer war, trat die reizende Dame rechts mit einer Kanne heißen Wassers an den Tisch und goss erneut auf.
Das Song Fang ist eher ungewöhnlich für Shanghaier Teehäuser, es wird betrieben von einer Französin mit Sinn für Design – es gibt ein eigenes Geschirr mit hübschem Retro-Logo – und ohne Scheu vor steilen Preisen, besonders im Shop; das Café ist bezahlbar. Es existieren inzwischen drei Filialen, die in der French Concession ist aber die netteste. Unten gibt es den Teeladen, in den oberen zwei Etagen sitzt man unter Vogelkäfigleuchten auf rotgeblümten Polstern.
227 Yongjia Lu, in der Nähe der Shaanxi Nan Lu
Mal wieder blau
Hier muss es irgendwo sein. Die Adresse stimmt. Aber wo…? Die Gasse hinein, einem verblassten Schild folgen, zweimal um die Ecke biegen, dann durch ein vergittertes halbrundes Tor: hier. Auf den Wäscheleinen trocknen Tücher in allen Größen, man duckt sich unter ihnen durch und erreicht: The Chinese Hand Printed Blue Nankeen Exhibition Hall. Blue Nankeen ist eine gut eintausend Jahre alte Handwerkskunst, blauweißer Stoffdruck. Eine Sojapaste wird mit Schablonen auf den Stoff aufgetragen, das Ganze in Indigo gefärbt, die Paste dann abgekratzt. Neben dem rummeligen kleinen Laden, der Jacken und Tischtücher in allen möglichen Mustern verkauft, gibt es eine sehr schöne Sammlung von alten Nankeen-Stücken, zusammengetragen von der japanischen Künstlerin Kubo Mase.
Und: klar. Blaues Hemd gekauft, musste sein.
The Chinese Hand Printed Blue Nankeen Exhibition, Nr. 24, Lane 637, Changle Lu
Selbstversuch Nr. 6391
Also, wie ein Cabernet Sauvignon sieht er schon mal nicht aus. Aber es steht ja auch nur „Cabernet“ drauf. Katerbericht folgt morgen.
Nachtrag: The day after. Leicht glasige Augen, unbestimmter Kopfschmerz hinten oben. Nichts, was eine Kanne Tee nicht in den Griff kriegen könnte. Das allerdings, nachdem ich die Hälfte der Flasche weggegossen habe.
Faketown
In einem Nebengang des vierstöckigen Fake Market hängt diese Notiz in einem Glaskasten. Ob es eine Anleitung zum Fälschen oder ein Verbot ist, weiß ich nicht – zumal ja jedes Verbot einen gewissen Aufforderungscharakter in sich birgt. Besonders in Shanghai: Gefälschte Taschen, Sonnenbrillen, T-Shirts gehören zum Stadtbild, die Ausbeute unten habe ich innerhalb einer halben Stunde gesammelt.
Am meisten interessieren mich dabei die Fälle, in denen die Anmutung von Luxus durch wildes Zusammenmixen von Labeln erzeugt wird. Das Louis-Vuitton-Karomuster im Miniformat mit pradaeskem Metallschild links oder die Gucci-typischen Trensen und Steigbügel im Vuitton-Stil rechts, da dreht der Label-Wahn dann mal amüsant durch.
Aber zurück zum Fake Market. Wer hier kaufen will, braucht vor allem starke Nerven. Es ist ein Spießrutenlaufen durch die Stände, und jeder, wirklich jeder Standbesitzer, kobert einen an. Hello lady, want bag? Hi lady, watch? Rolex! Want sunglasses? Hey lady, beautiful bag? Lady, Louis Vuitton, Prada, Gucci? Hello lady, bag! Lady! Anfangs schüttelt man nur den Kopf, aber ziemlich schnell muss man es einfach nur ignorieren und gehen, gehen, gehen, sonst wird man aggressiv. Ich habe den Sinn von Fakes nie verstanden und in Shanghai verstehe ich ihn noch weniger. Glaubt wirklich irgendeiner, dass er durch Tragen von offenkundlich nachgemachtem Schrott in der Achtung seiner Mitmenschen steigt? Gerade wenn Fälschungen so ubiquitär und inflationär sind wie hier, welche Bedeutung haben die Labels dann noch? Als Statussymbol taugen sie nicht mehr, nur noch als Zeichen dafür, dass man gern etwas hätte, was man nicht hat. (Über Sinn oder Unsinn von Luxuslabel im allgemeinen diskutieren wir dann ein andermal, ja?)
Nein, ich habe tatsächlich nichts gekauft, gar nichts. Aber am Ende bin ich doch kurz stehengeblieben, bei Hey lady, what do you want? Ich musste lachen. Großartige Frage, die ich mir oft selber stelle.
Wer es trotzdem nicht lassen kann: Fake Market, offiziell: Han City Fashion & Accessories Plaza, Nanjing Road West 580